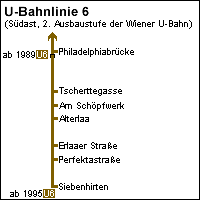| |
|
|
Als es Ende des 19. Jahrhunderts
galt, die auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben in Massen in die Reichshauptstadt
strömenden Einwohner der untergehenden Monarchie zu versorgen, war das offizielle Wien überfordert und gelähmt von
Politikern der Vergangenheit. Neben den sie erwartenden miserablen Arbeits- und
Lebensbedingungen war ihnen kein preiswerter öffentlicher Personentransport
ermöglicht. Wien platzte zu dieser Zeit aus allen Nähten, bei einer
Bevölkerungszahl von 2 Mio. Menschen (heute: 1,7 Mio.). Die
dampfbetriebene Stadtbahn war kaum realisiert, als es hochragende Pläne zur
Realisierung eines U-Bahnnetzes gab, so wie es das bereits seit 1896 in Budapest
(1 Linie), der Hauptstadt der anderen Reichshälfte, gab.
Erst die Übernahme des gesamten Straßenbahnnetzes ab
1903 durch die Stadt Wien ermöglichte eine kostengünstige Benutzung des
Transportmittels durch den damaligen "Durchschnittsbürger". Wie feine Äderchen
durchzogen die Strecken der Straßenbahn die Stadt ausgehend von der Ringstraße und
kleinen Teilen der historischen Innenstadt alle Bezirke und Vororte von Wien und so
wurde sie zum
einzigen wahren Massenverkehrsmittel der Stadt. U-Bahnpläne waren nach der
Implosion des zuletzt als "Kerker" verdammten Vielvölkerstaates nur mehr reine
Theorie. Politsysteme und Regime kamen und gingen, das Straßenbahnnetz blieb bis
heute.
Der Wunsch des Einzelnen, nur
dann frei zu sein, wenn man ein Automobil sein Eigen nennen kann, führte in den
Fünfzigern zum Aufkeimen der Idee einer autogerechten Stadt. In dieser Zeit war
das Gute von gestern das Alte des längst Vergangenem und wurde abgelehnt. Der
Fortschrittsglaube in der Technik und an das Neue allgemein beflügelte
Stadtplaner in ihren Visionen nur Neues zu schaffen und das Alte links liegen zu
lassen um es am Ende dem Neuen zu opfern. Darin besteht jedoch ihre Visions- und Ideenlosigkeit.
Als letzter
Hoffnungsschimmer für die Straßenbahn erschien, deren Tieferlegung an Stellen im
Netz, wo sie nur als Belastung für die Zukunft - pardon Autoverkehr - angesehen
wurde, da die U-Bahn sowohl politisch und finanziell in Wien noch ein Tabu war.
Durch diesen finanziellen Aufwand sollten die betroffenen Linien
beschleunigt werden, wobei Strecken ausgewählt wurden, die bereits auf einer
eigenen Trasse verliefen. Die Baumaßnahmen ließen kein klares Konzept für die
Erhaltung und Verbesserung des Straßenbahnnetzes erkennen, da die
Projekte, kaum realisiert, schlussendlich doch zu einem späteren Zeitpunkt in ein
U-Bahnnetz integriert werden sollten (Premetro-Konzept).
Über 75 Jahre des vergangenen Jahrhunderts bildete die Straßenbahn das Rückgrat
des öffentlichen Verkehrs in der Bundeshauptstadt. Wien verschläft so manchen
internationalen Trend in der Städteplanung und hinkt um Jahre hinterher - so
auch beim U-Bahnbau. Die Eröffnung des Grundnetzes erfolgte in einer Zeit als
die letzten Straßenbahnnetze in Europa stillgelegt wurden und global gesehen ein
Umdenkprozess einsetzte zugunsten der Straßenbahn.
U-Bahnbau ist nicht nur um
mindestens das fünf- bis zehnfache teurer als der Bau einer gleich langen Straßenbahnstrecke,
er dauert auch ein Vielfaches und er zerreist, so wie in Wien, mit der Stadt
gewachsene Systeme, da er nicht als Ergänzung zum Oberflächenverkehr erfolgt, sondern als
reiner Straßenbahnersatz realisiert wird, obwohl beide Systeme auf andere Zielgruppen von
Fahrgästen ausgerichtet sind (Beispiel: frühere Straßenbahnlinie 8 und Stadtbahnlinien G
und GD am Gürtel bis 1989).
Folgende Straßenbahnstrecken wurden in den Untergrund
verlegt:
 Straßenbahnstrecke am südlichen Gürtel -
Gürtel-USTRAB
Straßenbahnstrecke am südlichen Gürtel -
Gürtel-USTRAB
 Straßenbahnstrecke in der "Lastenstraße" -
Zweierlinie
Straßenbahnstrecke in der "Lastenstraße" -
Zweierlinie
 Wendeschleife bei der Station Schottenring -
Jonas-Reindl
Wendeschleife bei der Station Schottenring -
Jonas-Reindl
Weitere Premetro-Projekte:
 Strecke der
Straßenbahnlinie 64 zwischen Philadelphiabrücke und Siebenhirten
(1979-1995)
Strecke der
Straßenbahnlinie 64 zwischen Philadelphiabrücke und Siebenhirten
(1979-1995)

Die
Gürtel-USTRAB
Die
U-Strab auf dem Südteil des Gürtels entstand am 07.05.1959 mit der Eröffnung der
Unterführung unterhalb des Südtiroler Platzes für die Straßenbahnlinie 118 auf
dem Wiedner Gürtel. Am 11.01.1969 wurde die geradlinige Fortsetzung zwischen
Wiedner Gürtel und Margaretengürtel mit den Stationen Blechturmgasse, Kliebergasse,
Matzleinsdorfer Platz und Eichenstraße eröffnet.
Ab der Haltestelle Kliebergasse verläuft die 800m lange unterirdische Abzweigung
in Richtung Wiedner Hauptstraße mit der Station Laurenzgasse, die von den Linien
1 (seit 26.10.2008, davor Linie 65), 62 und der Wiener Lokalbahn (WLB) befahren
wird. Das Tunnelportal in der Wiedner Hauptstraße befindet sich an jener Stelle,
an der bis 1965 die Florianikirche (auch "Rauchfangkehrerkirche genannt") stand.
Der Bau der U-Strab wurde als Grund für den Abriss dieses "Verkehrshindernisses"
genannt, obwohl es schon vor dem 2. Weltkrieg Pläne gab sie abzureißen.
Vom Matzleinsdorfer Platz aus verläuft die 300m lange unterirdische Abzweigung
Richtung Süden, die von den Linien 1 (seit 26.10.2008, davor Linie 65) und 6
befahren wird.
Durch
den Bau wurden auch die Zufahrtsstrecken zur U-Strab der folgenden Linien
geändert:
 Linie 1 (damals 65):
Linie 1 (damals 65):
statt Triester Straße über Knöllgasse (südlich der U-Strab, die Strecke wurde
bereits 1967 gebaut).
 Linie 6:
Linie 6:
statt Gumpendorfer Straße ab Gürtel, Brückengasse, Nevillegasse,
Schönbrunner und Reinprechtsdorfer Straße über
Margaretengürtel (nördlich der U-Strab).
 Linie 6:
Linie 6:
statt Gudrunstraße über Knöllgasse und Quellenstraße (südlich der U-Strab).
Mit diesen Maßnahmen wurde
der 5. Bezirk, mit Ausnahme der Strecke in der Wiedner
Hauptstraße, mehr oder weniger straßenbahnfrei, da die
verbliebenen Strecken genau an der Bezirksgrenze
verlaufen.
Durch den Tunnel
verkehren heute (Stand: 2010):
 Linie 1 (bis 25.10.2008 Linie 65)
Linie 1 (bis 25.10.2008 Linie 65)
 Linie 6
Linie 6
 Linie 18
Linie 18
 Linie 62
Linie 62
 WLB (Lokalbahn Wien - Baden)
WLB (Lokalbahn Wien - Baden)

Pläne für eine Umstellung der Gürtel-USTRAB auf
U-Bahnbetrieb gab es in der Anfangsphase der U-Bahn, die jedoch seitdem ad acta
liegen, da die Schäden am Straßenbahnnetz zu groß wären.

Die "Zweierlinie"
Worin besteht der Vorteil eines Tunnels? Vorteile
wie: schnellere
Fahrt, direktere Verbindung, Entlastungsfunktion oder Zeitersparnis würde man
meinem. Nicht so bei beim Bau des
Zweierlinien-Tunnels in Wien.
Die unglückliche Streckenführung der Zweierlinien*
durch einen 1,8km langen Tunnel zwischen Sezession und Rathaus in der
"Lastenstraße"+ begann am 08.10.1966 als Wiens erste Unterpflasterstraßenbahn
(U-Strab) eröffnet wurde. Ab diesem Zeitpunkt war eine Umleitung der Ringlinien
(alle Straßenbahnen, die zumindest ein Stück des Rings befahren, heißen so) oder
Radiallinien zwischen Schottenring und Karlsplatz nicht mehr möglich, da alle
radial zum Ring hin- bzw. wegführenden Strecken nun keine Gleisverbindung mehr zur Zweierlinie hatten. Jedoch sind es gerade die häufigen Veranstaltungen auf
diesem Streckenstück die dazu führen, dass es auf dem betreffenden Ringabschnitt keinen
schienengebundenen öffentlichen Verkehr an der Oberfläche mehr gibt. Damit wurde die Zweierlinie
ihrer wichtigen Aufgabe beraubt als Umleitungsstrecke für den ringnahen
Straßenbahnverkehr zu
fungieren.
Diese Unflexibilität trägt zum negativen Image der Straßenbahn in Wien bis heute
bei.
+:
Lastenstraße:
Mehrnamiger, wenige hunderte Meter zum Ring parallel verlaufender Straßenzug.
Durch die bis 1980 dort verkehrenden Straßenbahnlinien auch "Zweierlinie"
genannt".
Ihre zweite große Bedeutung lag nun darin, mit den
letzten drei verbliebenen Straßenbahnlinien, die einen Index* führen, 11 (!) von 23 Bezirken der Stadt Wien
umsteigefrei miteinander zu verbinden.
*
Durchgangslinien und Index: Linien, die von einer Radial- auf eine
Tangentialstrecke und von dieser auf eine andere Radialstrecke wechseln, werden
in Wien als Durchgangslinie bezeichnet und statt mit einem Ziffern- mit einem
Buchstabensignal versehen. Da es sich bei der Zweierlinie um die 2. Tangente vom
Ring aus gesehen handelte, wurden dort verkehrende Durchgangslinien mit dem
Index 2 versehen (z. B. E2).
Nicht zu verwechseln ist der Begriff Durchgangslinie bei der Straßenbahn mit
Linien, die quer durch die Innenstadt verkehren, die es in Wien nie gab!
Die Tieferlegung einer wichtigen innerstädtischen
Ausweichstrecke, ihrer Aufgabe durch Kappung der Gleisverbindungen zu den
Zufahrtsstrecken beraubt, zeugt wie die Positionen der Tunnelportale von der
Konzeptlosigkeit des Baus. Diese befanden sich nämlich nach und nicht
vor zwei stark frequentierten Kreuzungen (wäre durch die Linie H2
bei der nördlichen Tunneleinfahrt auch nicht möglich gewesen), sodass etwaiger
Zeitgewinn im Tunnel an den Portalen gnadenlos aufgefressen wurde.
Bevorrangung
öffentlichen Verkehrs an Kreuzungen gab es damals noch nicht und noch heute
hinkt Wien, national als auch international gesehen, Lichtjahre hinterher. Zudem wurden die Linien
im Tunnel bis zuletzt mit altem Wagenmaterial und nicht mit damals modernen E1
oder E2 (gab es erst seit 1978) Gelenktriebwagen betrieben,
sondern mit langsamen Zweiachsern.
Der
U-STRAB-Tunnel verfügte über vier Stationen:
 Mariahilfer Straße (heute: Museumsquartier)
Mariahilfer Straße (heute: Museumsquartier)
 Burggasse (heute: Volkstheater)
Burggasse (heute: Volkstheater)
 Lerchenfelder Straße (als
U-Bahnstation 2003 aufgelassen)
Lerchenfelder Straße (als
U-Bahnstation 2003 aufgelassen)
 Friedrich-Schmidt-Platz (heute: Rathaus)
Friedrich-Schmidt-Platz (heute: Rathaus)
Zwischen 1966-1980 im Tunnel verkehrende
Straßenbahnlinien:
|
Linie |
Strecke |
Bezirke, die
umsteigefrei verbunden waren |
|
Linie E2 |
Herbeckstraße - Praterstern |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 19 |
|
Linie G2 |
Hohe Warte - Radetzkystraße |
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18 |
|
Linie H2 |
Hernals - Prater Hauptallee |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17 |
Die Zweierlinien im Tunnel in der
Straßenbahn-Ära (1966-1980)
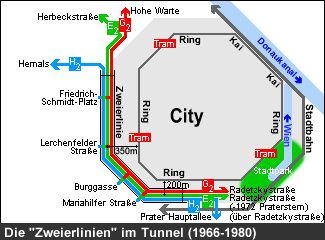
Von der Straßenbahn zur U-Bahn
Am 26.01.1968 wurde im Gemeinderat (zugleich
Landtag) offiziell der Beschluss gefasst, ein aus 3 Linien (U1, U2 und U4)
bestehendes Grundnetz zu bauen. Während die U1 durch einen Komplettneubau und
die U4 aus Teilen der Stadtbahn entstand, sollte die U2 durch die
beiderseitige Verlängerung des Zweierlinien-Tunnels Richtung Karlsplatz im Süden
und Schottenring im Norden gebaut werden. Dabei wurde in Kauf genommen, dass 3 lange
Durchgangslinien der Straßenbahn zerstückelt wurden und stattdessen eine 3,4km kurze
U-Bahnlinie, die nur durch Umsteigen und lange Zugangswege erreicht werden kann,
geschaffen wurde.
Diese U2 ist eigentlich ein Konstrukt aus
Streckenästen der
geplanten U2 und U5. Zwischen den Stationen Rathaus und Schottentor beim
Landesgericht sollte aufgrund der hohen Baukosten u. a. in einer späteren
Ausbauphase der U-Bahn eine Strecke nach Hernals (Streckenast der U5, Ersatz der
Straßenbahnlinie 43) realisiert werden. So wurden die für das Grundnetz der
U-Bahn realisierten Äste einfach miteinander verbunden. An dieser Stelle befindet sich so bis heute der engste Kurvenradius des
U-Bahnnetzes, wodurch die U2, 2008 wurde diese zum Stadion verlängert, durch die Bauvorgaben des früheren
Straßenbahntunnels, auf dem Streckenstück Karlsplatz - Schottenring zur
langsamsten Strecke im ganzen Netz gehört.
Die
Zweierlinie in Zeiten der U-Bahn-Ära
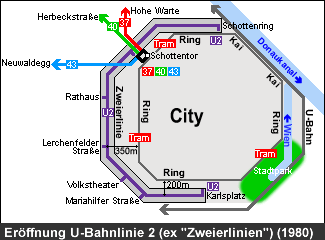
Die Zerstückelung der drei
Zweierlinien:
Infolge der U2 sind die Endpunkte entlang der früheren Zweierlinien nur mehr
durch mehrmaliges Umsteigen zu erreichen (z. T. viermal!).
In der rechten Spalte sind mögliche alternative Streckenvarianten beschrieben,
um die Endstationen der früheren Zweierlinien zu erreichen (geringere Anzahl
an Umsteigevorgängen), ohne dabei Rücksicht auf den früheren Streckenverlauf der
Zweierlinien zu nehmen.
|
Zweierlinie |
Ersatz
durch Linie |
Streckstücke der Linien, die seit 1980 die Zweierlinien ersetzen |
Alternative Streckenstücke und Linien seit 1980 |
|
Linie E2:
|
40
U2
U4
O
|
Herbeckstraße - Schottentor
Schottentor - Karlsplatz
Karlsplatz - Landstraße
Landstraße - Praterstern
|
-
bis
09.05.2008°:
1 Schottentor - Schwedenplatz
U1 Schwedenplatz - Praterstern
seit 10.05.2008°:
U2 Schottentor - Praterstern |
|
Linie G2: |
37
U2
U4
O
|
Hohe Warte - Schottentor
Schottentor - Karlsplatz
Karlsplatz - Landstraße
Landstraße - Radetzkystraße
|
-
bis
25.10.2008*:
1 Schottentor - Schwedenplatz
N Schwedenplatz - Radetzkystr.
seit 26.10.2008*:
1 Schottentor -
Radetzkystraße |
|
Linie H2:
|
43
U2
U4
O
N (1)*
|
Linie 43: Hernals - Schottentor
Schottentor -
Karlsplatz
Karlsplatz - Landstraße
Landstraße - Radetzkystraße
Radetzkystraße - Prater Hauptallee |
bis
25.10.2008*:
1 Schottentor - Schwedenplatz
N Schwedenpl. - Prater Hauptallee
seit 26.10.2008*:
1 Schottentor - Prater
Hauptallee |
Fußnoten:
*: mit 26.10.2008 wurden die Ringlinien umstrukturiert und so neue
Durchgangslinien geschaffen
°: Verlängerung der U2 bis Stadion
|

Das "Jonas-Reindl"
Bis auf wenige Wendeschleifen und
kurze Streckenstücke hat die Straßenbahn in Wien noch nie die historische
Innenstadt, Zentrum ist dabei zweifelsohne der Stephansplatz, berührt. In den
Fünfzigern und Sechzigern wollte man noch dieses Manko beheben und unterirdische
Straßenbahnstrecken quer durch die Innenstadt bauen und so stark frequentierte
Strecken miteinander verbinden, um so Umsteigevorgänge zu minimieren und die
Straßenbahn attraktiver machen.
Als Vorleistung wurde hierzu die Endstation der Straßenbahn beim Schottentor
umgebaut. Es entstand ein zweigeschossiger Bau mit einer ober- und einer
unterirdischen Wendeschleife, die aber nach oben hin offen ist. Alle anderen
Wendeschleifen im Bereich Schottentor wurden hierauf stillgelegt. Da der Bau, der
am 15.02.1960 vom Bürgermeister Franz Jonas eröffnet wurde, der Form nach
einer Bratpfanne, auf österreichisch "Reindl", ähnelt, erhielt er die
Bezeichnung "Jonas-Reindl".
Die Errichtung dieses Bauwerks musste als Begründung für die Stilllegung der
Durchgangslinien C und F herhalten.
Teile der Unterquerungen durch die Innenstadt wurden durch den Bau der U1 (1978/79) und U3 (1991)
realisiert, wenn auch noch immer großes Potential vorhanden ist, z. B Linien vom
"Jonas-Reindl" zumindest bis zum Stephansplatz oder darüber hinaus
über den
Karlsplatz zu verlängern, um in der Innenstadt U-Bahn und Straßenbahn, die
beiden leistungsfähigsten öffentlichen Verkehrsnetze der Stadt, zu verknüpfen.

Straßenbahnlinie 64 nach Siebenhirten
(1979-1995)
 Ende
der 1970er wurden im Süden von Wien große neue Wohnhausanlagen (in Siebenhirten,
Alterlaa und Am Schöpfwerk) errichtet. Ende
der 1970er wurden im Süden von Wien große neue Wohnhausanlagen (in Siebenhirten,
Alterlaa und Am Schöpfwerk) errichtet.
Ein leistungsfähiges Massenverkehrsmittel sollte diese Gebiete
erschließen. Man entschloss sich vorläufig für die Straßenbahn. Die zu
errichtende Schnellstraßenbahnstrecke sollte zu einem späteren Zeitpunkt in das
U-Bahnnetz integriert werden.
Am 27.09.1979 wurde die neue Strecke zwischen Philadelphiabrücke und Rößlergasse
eröffnet. Am 27.09.1980 erfolgte die Verlängerung der Strecke bis nach
Siebenhirten. Die neue Straßenbahnlinie 64 verkehrte zwischen Westbahnhof und
Rößlergasse bzw. Siebenhirten.
Erstmalig verlief eine Straßenbahnlinie in Wien nahezu auf eigenem Gleiskörper.
Auch wurde die Linie für gewöhnlich nur mit der neuesten Generation an
Straßenbahngarnituren (E2) betrieben. Die Strecke wurde mit einer
modernen Kettenfahrleitung ausgestattet, zudem verlief ein Teil der Strecke auf
einem über einem Kilometer langen Viadukt.
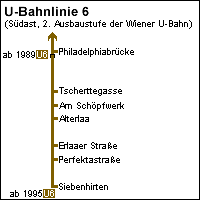
Mit der Umbenennung der Gürtellinie der Stadtbahn in U6 und deren Verlängerung
bis zur Haltestelle "Philadelphiabrücke" am 07.10.1989 wurde die seit jeher
parallel zur Gürtellinie verkehrende Straßenbahnlinie 8 eingestellt und die
Linie 64 gekürzt. Die Linie 64 hatte somit ihre nördliche Endstation in der Murlingengasse, dort wo bisher die Linie 8 ihre südliche Endstation hatte.
Ursprünglich hätte die U6 bei der Verlängerung in den Süden Wiens die Strecke
der Straßenbahnlinie 64 übernehmen sollten. Stattdessen wurden nur die Stationen
"Tscherttegasse" und "(Wohnpark) Alterlaa" übernommen, die Haltestellen
"Wienerbergstraße", "Rößlergasse" und "Wienerflur" aufgelassen und die gesamte
Strecke ab Philadelphiabrücke neu gebaut. Während der Umbauarbeiten verkehrte
die Linie 64 auf provisorischen Streckenstücken. Nach der Fertigstellung
einzelner Etappen der neuen U-Bahnstrecke wurden diese von der Straßenbahn
benützt.
Am 07.04.1995 wurde die Linie 64 eingestellt, ein einwöchiger
Schienenersatzverkehr ermöglichte noch notwendige Umbauarbeiten, bevor am
15.04.1995 die U6 nach Siebenhirten verlängert wurde. Damit gehörte Wiens erste
und bisher einzige Schnellstraßenbahnlinie der Geschichte an.
Bis 2000 wurde nur jeder zweite U-Bahn-Zug bis nach Siebenhirten geführt, die
restlichen Wagen hatten ihre Endstation bereits bei der Station Alterlaa. Seither werden alle Züge nach Siebenhirten geführt, jedoch
sind diese schwach ausgelastet (3 bis 6-Minuten-Intervall, Stand 2010,
ausgenommen Hochsommer- und Weihnachtsferien).
Der Ersatz einer erst 15 Jahre alten Premetro-Strecke, sowie der laufende dichte
Intervall auf einer Strecke, die die dafür zu rechtfertigenden Fahrgastzahlen
nicht aufweist - objektive Maßstäbe vorausgesetzt - lassen Zweifler an dieser
Umstellung nicht verstummen.

|
|
|
|
|
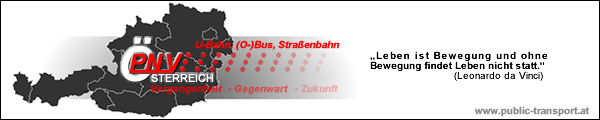

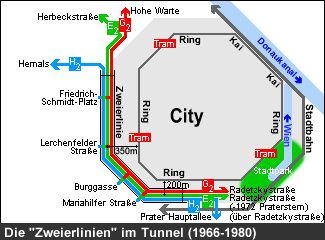
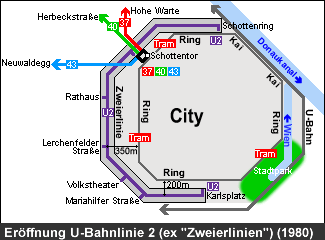
 Ende
der 1970er wurden im Süden von Wien große neue Wohnhausanlagen (in Siebenhirten,
Alterlaa und Am Schöpfwerk) errichtet.
Ende
der 1970er wurden im Süden von Wien große neue Wohnhausanlagen (in Siebenhirten,
Alterlaa und Am Schöpfwerk) errichtet.